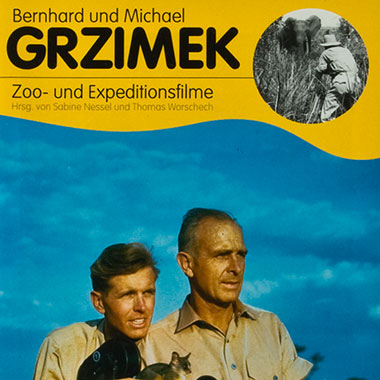Casablanca. Deutsche Synchronfassung

© Nils Daniel Peiler
Spiel es, Sam, spiel’s von Zelluloid
von Nils Daniel Peiler
Es gibt sie noch, die werkgetreuen Aufführungen, bei denen man Filmklassiker von dem Material sehen kann, auf dem und für das sie entstanden sind. Nicht in der Breite gewiss, kaum mehr im Heimkino, auch nicht in den großen Kinosälen, dafür auf ausgewählten Festivals, in Museen und nicht zuletzt dort, wo zukünftige Filmexperten wissenschaftlich auf ihr Medium vorbereitet werden: an der Universität.
So wie Kunsthistoriker in Zeiten hochauflösender digitaler Reproduktionen der schönsten Gemälde dieser Welt noch immer das Studium vor den Originalen im Museum schätzen, so wie Buchwissenschaftler in Zeiten der E-Books und Bildschirmreader noch immer dem gedruckten Papier Beachtung schenken, so reizt es auch den Filmwissenschaftler mit Faible für die Geschichte und Materialität seines Mediums in Zeiten der scheinbaren Verflüchtigung des analogen Films, eine alte, zerkratzte Kopie zu sichten. Jener Trägerstreifen mit Einzelbildern und Tonspur scheint an Brillanz, Bilddynamik und Detailauflösung einem durchschnittlichen Digitalisat mitunter noch immer überlegen. Von „Casablanca“, das ist die Ironie der großen Filmklassiker, ist uns zwar das originale Kameranegativ von 1942 erhalten geblieben, da jedoch der Film so oft kopiert, die Negativvorlage also zu stark benutzt wurde, ist eben dieses Original unbrauchbar geworden. In einem solchen Moment steigt automatisch der Wert aller noch verbliebenen Vorführkopien eines Films ungemein.
Im Falle der vorliegenden 16mm-Schmalfilmkopie, die aus dem aufgelösten Bestand des Atlas-Filmverleihs (einst der größte nichtgewerbliche Verleiher Europas) an das Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft gekommen ist, handelt es sich um eine vom originären 35mm-Kinoformat umkopierte deutsche Synchronfassung von „Casablanca“ auf 16mm-Schmalfilm. Die im Auftrag der ARD unter der Regie von Wolfgang Schick entstandene Synchronisation lässt sich auf die Zeit nach 1975 datieren. Wir sehen Humphrey Bogart, hören aber Joachim Kemmer, wir sehen Ingrid Bergman, lauschen aber Rosemarie Kirstein – selbst die in die Vereinigten Staaten von Amerika emigrierten Muttersprachler Peter Lorre und Conrad Veidt sprechen nicht mit ihren eigenen Stimmen, sondern durch Horst Gentzen und Wolfgang Preiss zu uns.
So erzählt die Frankfurter Atlas-Kopie der Regiearbeit Michael Curtiz’ auch ein Stück Filmsynchrongeschichte: Bereits 1952, zehn Jahre nach dem amerikanischen Start des Films, gab es eine ideologisch bearbeitete erste deutsche Synchronfassung, in der freilich, sieben Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, jegliche Hinweise auf die gesamte nationalsozialistische Rahmenhandlung des Plots so abgeändert wurden, dass eine unpolitische Agentengeschichte daraus entstand. Damit wurde der Film seiner eigentlichen Botschaft vollständig beraubt. Auch das wohl berühmteste Dialogzitat – „Ich schau dir in die Augen, Kleines“ – stammt mitnichten von Hauptdarsteller Humphrey Bogart oder Regisseur Michael Curtiz, sondern eben von dem deutschen Synchronregisseur Wolfgang Schick – eine Praxis, die bei Synchronfassungen dieser Epoche gängig war.
Werkgetreu verhält sich hingegen die – bis auf das weggeschnittene Start- und Endlogo sowie einige Sekundenbruchteile früher abblendende Szenen – nahezu vollständige schwarz-weiße Frankfurter Schmalfilmkopie. Wenn Bogart und Bergman zu „Perfidia“ tanzen, scheint alles zu stimmen. In kontrastreichem, scharf gestochenem Schwarz-Weiß gleiten die Körper zu Alberto Domínguez’ Song über die Tanzfläche, auf der sich, wie feine helle Tupfer, die Reflexionen der Lichter der Discokugel abzeichnen. Das Filmformat zeigt seinen vollen Glanz auch, wenn wir die Protagonistin in Naheinstellungen zu Gesicht bekommen: In Bergmans Frisur lassen sich selbst in der reduzierten Schmalfilmkopie einzelne Strähnen erkennen, während ihr Haar auf Digitalisaten des Films zu einem Schopf verschmilzt; selbst die Stofflichkeit der Kleider ist auf der nur selten vorgeführten und daher wenig abgenutzten Frankfurter 16mm-Kopie noch wunderbar erhalten, während eine DVD allenfalls erahnen lässt, welches Kostüm die Bergman trägt.
Mit dem wiederkehrenden Song „As Time Goes By“, einer Nummer Herman Hupfelds, die ursprünglich bereits 1931 für eine Revue komponiert wurde, aber zu jenem berühmten Song avancierte, der die Vergangenheit und das Wiederaufleben der Pariser Liebesaffäre zwischen Bogart und Bergman im Film musikalisch umsetzt, hat die Verleihfirma Warner Bros. dem Film ein anhaltendes Denkmal gesetzt. Nicht nur, dass „Casablanca“ auch mehr als sieben Jahrzehnte nach seinem Kinostart noch immer Geld in die Kassen des Studios spült, „As Time Goes By“ erklingt auch als musikalisches Signet vor jedem neuen Film des Studios im Rahmen des Production Logos – und dies auch vor digital hergestellten Filmen, denn Warner Bros. liefert seit Frühjahr 2014 für neu startende Filme keine analogen 35mm-Filmkopien mehr aus. As time goes by.
Der Autor ist International Master in Audiovisual and Cinema Studies. Der Text entstand im Rahmen der Jubiläumsausstellung „Ich sehe wunderbare Dinge. 100 Jahre Sammlungen der Goethe Universität“ und wurde im Katalog veröffentlicht. Dieses Objekt war in der Jubiläumsausstellung "Ich sehe wunderbare Dinge. 100 Jahre Sammlungen der Goethe-Universität" 2014/2015 zu sehen. Der erläuternde Text wurde für die Ausstellung bzw. den begleitend erschienenden Katalog verfasst.
Literatur
Anna Bohn: Denkmal Film, Bd. 1: Der Film als Kulturerbe, Köln 2013.
Thomas Bräutigam: Stars und ihre deutschen Stimmen. Lexikon der Synchronsprecher, 3. Aufl., Marburg 2013.
Frank Miller: Casablanca as time goes by. Mythos und Legende eines Kultfilms, München 1992.